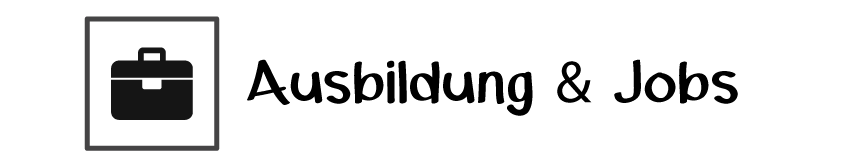Die größten Missverständnisse rund um SAFe entlarvt1. Ist SAFe überhaupt agil?
Ein häufiges Missverständnis: SAFe sei zu starr und verliere die Agilität, die es eigentlich fördern soll. Tatsächlich basiert SAFe jedoch auf etablierten agilen Frameworks wie Scrum und Kanban und integriert deren Prinzipien auf skalierter Ebene. Wenn es in der Praxis zu Problemen kommt, liegt dies oft nicht am Framework selbst, sondern an einer falschen oder unvollständigen Umsetzung der agilen Werte. Die Iterationen und Rollen bleiben identisch, es ändern sich lediglich Begriffe und Skalierungsmechanismen, um größere Teams besser zu koordinieren.
2. Keine Anpassung an individuelle Bedürfnisse?
Kritiker werfen SAFe vor, es sei ein unflexibles Korsett. Doch das Gegenteil ist der Fall: SAFe bietet eine Vielzahl an Werkzeugen und Methoden, die individuell auf die Bedürfnisse eines Unternehmens zugeschnitten werden können. Das Framework versteht sich als umfassender Werkzeugkasten – nicht jede Methode oder Struktur muss genutzt werden. Unternehmen, die SAFe erfolgreich implementieren, passen es an ihre bestehenden Prozesse und Bedürfnisse an, anstatt blind alle Vorgaben zu übernehmen.
3. Management von Abhängigkeiten statt ihrer Beseitigung
Ein zentraler Kritikpunkt lautet, dass SAFe Abhängigkeiten lediglich verwalte, anstatt sie zu beseitigen. In Wirklichkeit verfolgt SAFe genau das Ziel, Abhängigkeiten so weit wie möglich zu reduzieren, beispielsweise durch synchrone Entwicklungszyklen oder die Verbesserung der technischen Architektur. Gleichzeitig erkennt SAFe jedoch an, dass nicht alle Abhängigkeiten sofort aufgelöst werden können. In diesen Fällen sorgen Tools wie der "ART Sync" oder “Scrum of Scrums” dafür, dass Abhängigkeiten effizient gemanagt werden, bis sie langfristig gelöst sind.
4. Ist SAFe zu bürokratisch?
Für Einsteiger mag SAFe komplex wirken, insbesondere aufgrund der Vielzahl an Rollen, Meetings und Artefakten. Doch diese Strukturen dienen einem klaren Zweck: Sie fördern die Transparenz und Abstimmung in großen Teams. Ähnlich wie bei Scrum oder Kanban liegt der Fokus darauf, soziale Systeme effizient zu organisieren. Entscheidend ist, nur die Mechanismen zu nutzen, die tatsächlich einen Mehrwert bieten. Eine übermäßige Bürokratisierung entsteht meist, wenn das Framework starr implementiert wird, ohne es auf die Organisation abzustimmen.
5. Herausforderungen bei der Implementierung von SAFe
Die erfolgreiche Einführung von SAFe erfordert einen klaren Plan und die Unterstützung der gesamten Organisation. Häufig scheitert die Implementierung, wenn Teams nicht ausreichend in agilen Prinzipien geschult sind oder wenn die Führungsebene nicht aktiv eingebunden wird. SAFe funktioniert am besten, wenn alle Beteiligten ein grundlegendes Verständnis für Scrum, Kanban und agiles Arbeiten mitbringen. Führungskräfte spielen eine Schlüsselrolle: Sie müssen den Wandel aktiv begleiten, ein agiles Mindset fördern und sicherstellen, dass das Framework auf die individuellen Gegebenheiten des Unternehmens angepasst wird.
Was kann ich für mein Projekt daraus lernen?
Die Einführung von SAFe in Ihrem Unternehmen erfordert eine gründliche Vorbereitung und das Bewusstsein, dass das Framework kein universeller Problemlöser ist. Beginnen Sie mit einer ehrlichen Analyse Ihrer aktuellen Prozesse und Herausforderungen. Wählen Sie dann nur die Elemente von SAFe, die wirklich Mehrwert bieten, und passen Sie diese individuell an. Achten Sie darauf, dass agile Prinzipien auf Teamebene solide umgesetzt sind, bevor Sie die Skalierung angehen. Nur mit einem klaren Fokus auf Anpassbarkeit und kontinuierliches Lernen wird SAFe die gewünschten Ergebnisse liefern.
Zusammenfassung
- SAFe ist agil, basiert auf Scrum und Kanban und integriert deren Prinzipien auf skalierter Ebene.
- Missverständnisse entstehen oft durch fehlerhafte Umsetzung und mangelnde Schulung.
- SAFe ist ein flexibler Werkzeugkasten, der individuell angepasst werden kann.
- Das Framework hilft, Abhängigkeiten zu managen und langfristig zu beseitigen.
- Komplexität entsteht oft durch sture Implementierung, nicht durch das Framework selbst.
- Erfolgreiche Einführung erfordert erfahrene Teams und geschulte Führungskräfte.
- SAFe eignet sich besonders für große Organisationen mit mehreren Teams.
- Die Unterstützung der Führung ist entscheidend für die Einführung agiler Methoden.
- Der Fokus liegt auf Wertschöpfung durch kurze Entwicklungszyklen.
- Eine unreflektierte Einführung ohne Anpassung an die Organisation führt zu Problemen.
Der Vortrag "SAFe – Großer Scheiß oder großes Kino?" von Malte Foegen war Teil des PM Forum Digital am 7. und 8. November 2024 in Hamburg. Mit vier exklusiven Keynotes und über 50 Referierenden präsentierte das PM Forum praxisnahe Lösungen und zukunftsweisende Strategien, die die Teilnehmenden in ihrer Projektarbeit unterstützen und nachhaltig inspirieren. Mehr zur Veranstaltung erfahren Sie hier: https://www.pm-forum.de/pm-forum-digital/
Die GPM Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement e. V. ist ein gemeinnütziger Fachverband für Projektmanagement. 1979 gegründet bildet die GPM heute ein weitreichendes Netzwerk für Projektmanagement-Expertinnen und -Experten aus allen Bereichen der Wirtschaft, der Hochschulen und der öffentlichen Institutionen. Der Fachverband trägt wesentlich zur Professionalisierung und Weiterentwicklung des Projektmanagements in Deutschland bei und bietet umfangreiche Möglichkeiten zur Aus- und Weiterbildung sowie zur Zertifizierung im Projektmanagement. Über den Dachverband International Project Management Association (IPMA) ist die GPM weltweit vernetzt und bringt auch auf internationaler Ebene die Arbeit an Normen und Standards voran. Mehr dazu unter www.gpm-ipma.de
GPM Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement e.V.
Am Tullnaupark 15
90402 Nürnberg
Telefon: +49 (911) 433369-0
Telefax: +49 (911) 433369-99
http://www.GPM-IPMA.de
PR Managerin I Online- und Bewegtbildredaktion
Telefon: +49 (911) 433369-53
E-Mail: k.baeumel@gpm-ipma.de
![]()